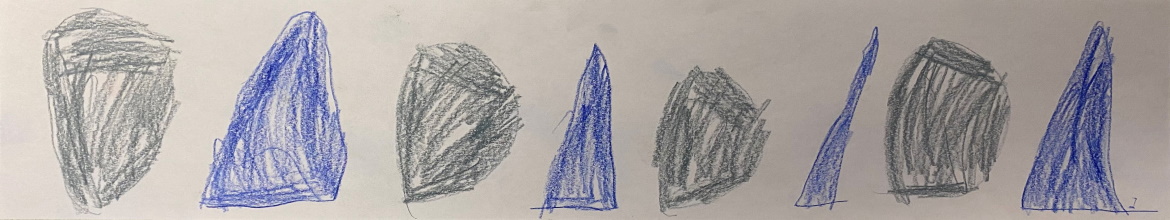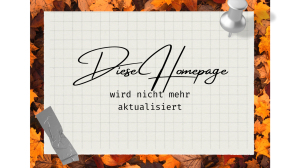Durch die Entwicklung des Internets stehen wir am Anfang des nächsten Leitmedienwechsels. Lehrpersonen bereiten Schülerinnen und Schüler (SuS) so gut wie möglich auf die veränderte Welt vor und unterstützen sie darin, sich in der Informationsflut und den Tausenden von Möglichkeiten zurechtzufinden. Die Schule begleitet die Jugendlichen bei der Findung und Definierung ihrer “digitalen” Identität.
Nebst Lesen, Schreiben und Rechnen gehört heute der Umgang mit ICT zur Grundkompetenz eines mündigen Menschen. Wir sprechen somit von einer neuen, vierten Kulturkompetenz, welche in ihrer Wichtigkeit den anderen ebenbürtig ist: Der zielgerichtete Umgang mit ICT.
Grundsätzlich werden die Ziele gemäss Lehrplan 21 und den ICT-Regelstandards des Kantons Solothurn in Form von Kompetenzen und Handlungsfeldern der Volksschule vorgegeben.
Pädagogisches Konzept
Kindergarten (KG) bis 2. Klasse (Zyklus 1)
Das Ziel der Integration von ICT im Unterricht auf dieser Stufe besteht darin, die SuS zu einem sinnvollen Umgang mit digitalen Medien zu erziehen. Im Kanton Solothurn hat die informatische Bildung keine Priorität im ersten Zyklus und folgedessen wird keine dezidierte Informatik Lektion zur Verfügung gestellt. Folgende Bereiche werden im regulären Unterricht bearbeitet:
Ausgewählte Zielsetzungen Bereich Informatik
Die Schülerinnen und Schüler...
- können Geräte ein- und ausschalten, Programme starten und beenden, einfache Funktionen nutzen.
- können Dokumente selbständig ablegen und wiederfinden.
- können mit grundlegenden Elementen der Bedienoberfläche umgehen (Fenster, Menüs, mehrere geöffnete Programme).
- können Dinge sortieren und Rezepte und Abläufe befolgen.
Ausgewählte Zielsetzungen Bereich Medien
Die Schülerinnen und Schüler...
- können die Medien benennen, welche sie zur Unterhaltung, zur Information und zur Kommunikation nutzen.
- können benennen, welche unmittelbaren Emotionen die eigene Mediennutzung auslöst (z.B. Freude, Wut, Trauer).
- können einfache Beiträge in verschiedenen Mediensprachen verstehen und darüber sprechen (Text, Bild, Ton, Film…).
- können erzählen, was sie durch Medien erfahren haben.
- können einfache Bild-, Text-, Tondokumente gestalten und präsentieren.
- können spielerische, digitale Lernangebote nutzen (z.B. Apps, Webseiten, Lernsoftware).
3.-6. Klassen (2. Zyklus)
Das Ziel der Integration von ICT im Unterricht auf der Primarstufe besteht darin, den SuS digitale Medien als Werkzeuge näher zu bringen, die sie beim Lernen durchaus auch spielerisch unterstützen können. Ebenso sollen die SuS ab der 3. Klasse in die Grundlagen (Textverarbeitung, Präsentationstools, Bildbearbeitung, Programmierung) der Arbeit am Computer eingeführt werden.
Ausgewählte Zielsetzungen Bereich Informatik
Die Schülerinnen und Schüler...
- können mit einer blockbasierten Programmiersprache (Code.org, Scratch,...) programmieren.
- können unterschiedliche Darstellungsformen für Daten verwenden (z.B. Symbole, Tabellen, Grafiken).
- können durch Probieren Lösungswege für einfache Problemstellungen suchen und auf Korrektheit prüfen
- können Betriebssystem und Anwendungssoftware unterscheiden.
- können erklären, wie Daten verloren gehen können und kennen die wichtigsten Massnahmen, sich davor zu schützen.
- können lokale Geräte, lokales Netzwerk und das Internet als Speicherorte für private und öffentliche Daten unterscheiden.
- können die wesentlichen Bestandteile eines Computers benennen.
- können die Grundprinzipien der Codierung (Bits und Bytes) verstehen.
Ausgewählte Zielsetzungen Bereich Medien
Die Schülerinnen und Schüler...
- können Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen (z.B. Identitätsbildung, Cyber-mobbing).
- kennen die Grundprinzipien des Copyrights für ihre persönliche kreative Arbeit und kennzeichnen dies durch Quellenangaben
- können Medien für gemeinsames Arbeiten und für Meinungsaustausch einsetzen und dabei die Sicherheitsregeln befolgen.
- können mit grundlegenden Elementen der Bedienungsoberfläche umgehen.
- können grundlegende Sicherheitsregeln in der Nutzung von Netzwerken anwenden (z.B. Umgang mit persönlichen Daten).
- können die Gefahr erkennen, dass Inhalte digitaler Medien mit einfachen Mitteln veränderbar sind.
- wissen, dass digitale Daten manipulierbar sind, und kennen Verhaltensweisen für den Umgang mit problematischen Inhalten
Rahmenbedingungen
Damit das pädagogische Konzept umgesetzt werden kann, muss die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.
Die favorisierte Client-Infrastruktur beinhaltet zwei Notebookpools (Feld 17 Notebooks, Dorf 12 Notebooks), 5 iPads für pro 1. und 2. Klasse und 2 vernetzte Schülernotebooks, ein Lehrerarbeitsnotebook (pro 100 Stellenprozente bzw. pro Klasse) und einen Beamer pro Klassenzimmer fest installiert, sowie die notwendigen Peripheriegeräte. Tablets und Notebooks haben beide ihre Vor- und Nachteile und das eine Gerät kann (noch) nicht vollumfänglich die Funktionen des anderen übernehmen. Der Kanton empfiehlt beide Gerätearten einzusetzen.
Als sehr wertvoll wird der Einsatz von Tablets im KIGA, im integrativen Förderunterricht und auch im Unterricht auf der Unterstufe erachtet. Diese Tablets werden von einer zentralen Managementlösung verwaltet. Um alle Kompetenzziele des LP21 zu erfüllen, ist der Einsatz von Notebooks oder Convertibles im Zyklus 2 nach wie vor notwendig.
In den letzten Jahren hat Mobile Computing immer mehr an Stellenwert gewonnen. Auf der Stufe Zyklus 1 soll vermehrt auf Tablets gesetzt werden. Die haptische Bedienung kommt den SchülerInnen dieser Stufe sehr entgegen. Zudem existieren für den Zyklus 1 auch viele gute Apps.
Ab Zyklus 2 (Mittelstufe) muss es einer Lehrperson möglich sein, in einem “1-to-1-computing” Setup zu unterrichten. Das heisst, es sind Unterrichtssequenzen möglich, in denen jeder SuS einen eigenen Laptop zu Verfügung hat. Dies ist zur Zeit im Halbklassenunterricht machbar.
Tastaturschreiben
Das blinde, perfekte Schreiben am Computer ist nicht mehr Hauptziel im LP21. Freiwillig ist im Deutschunterricht der Einsatz von Tastaturschreibeprogrammen (z.B. Tipp10) möglich.
Technisches Konzept
ICT-Infrastuktur für die Primarstufe
Eine Vernetzung mit dem Internet ist Dank Schulen ans Internet und Yetnet in allen Kindergärten und Primarschulhäusern gegeben. In den Schulzimmern stehen fest verkabelte Netzwerkdosen zur Verfügung. Beide Primarschulhäuser sind mittels einer Glasfaserleitung fest verbunden.
Das WLAN Netzwerk ist ein gemanagtes System, in welchem alle Accesspoints eines Subnetzes zentral konfiguriert und gewartet werden können. Zudem ist es beliebig erweiterbar. Es genügt auch den Anforderungen an mobiles Computing. Die Anzahl der Accesspoints und deren Standorte werden periodisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Die Website soll wie bis anhin weitergeführt werden. Technisch wurde die Site 2018 überarbeitet. Inhaltlich wird sie den Datenschutzbestimmungen angepasst.
Nur ein professionelles Wartungs- und Supportkonzept gewährleistet einen ungehinderten Einsatz der Infrastruktur im Unterricht. Der Support soll hauptsächlich wie bis anhin durch zwei pädagogische und technische ICT- Supporter durchgeführt werden. Nur so kann eine rasche und niederschwellige Problemlösung und Hilfestellung gewährleistet werden. Für den weiteren Support, soll wie bis anhin eine spezialisierte Firma beigezogen werden können.
Software
Bei der Software soll weiterhin auf die bewährten Programme von Microsoft gesetzt werden. Das Mietmodell für Schulen bietet eine flexible und kostengünstige Lösung, um alle Office Programme immer auf dem neuesten Stand zu halten. Zudem harmonieren sie hervorragend mit der Maillösung von Office365.
Schönenwerd ist bestrebt, möglichst mit Webtools zu arbeiten, um die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Apps vollkommen auszuschöpfen.
Identity- und Access-Management
Alle Lehrpersonen besitzen eine Emailadresse unter der Domain schulenschoenenwerd.ch. Diese dient zur geschäftlichen Kommunikation.
Ab der 5. Klasse erhalten die Schüler und Schülerinnen ihren eigenen Office Account, der über die Schuldomain läuft. Dadurch erhalten sie Zugriff auf die Web-Varianten sämtlicher Office-Apps und können gemeinsame Arbeiten besser koordinieren, sowie ihre Daten leichter verwalten. Auch besteht damit die möglich Schülerinnen und Schülern, die zuhause keinen Zugang zu den lizenzierten Offline-Varianten haben, diese zur Verfügung zu stellen.
Rechtliche Aspekte mit Richtlinien und Empfehlungen
Die Eltern unterschreiben beim Eintritt in den Kindergarten bzw. beim Neueintritt in die Schule für Zugezogene die Schulvereinbarung. Darin wird unter anderem der gewissenhafte Umgang mit Laptops, iPads und Internet in der Schule geregelt.
Für die Weiterverwendung von Fotos ihrer Kinder für unsere Schulhomepage erhalten die Eltern eine Einverständniserklärung zum Unterschreiben.
Schulvereinbarung und Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos der Kinder finden sich hier.
ICT Konzept - Version aktualisiert im März 2019
Das ICT Konzept der Schule Schönenwerd unterliegt der CC Lizenz, was bedeutet:
Das Konzept kann frei verwendet werden (cc). Unser Name (by) muss angegeben werden. es darf nicht kommerziell (nc) genutzt werden und muss unter den gleichen Bedingungen weitergegeben werden (sa).
Dieses Konzept baut auf dem ICT Konzept der Schule Konolfingen auf.